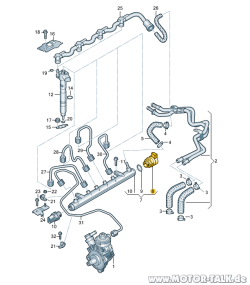«Nachts sind alle Katzen grau», sagt der Volksmund – und liegt falsch, wie leider so oft. Ja, gewiss, meine Damen und Herren, einige Katzen sind nachts grau – und auch am Tage. Jedoch: Ein paar sind grauer als andere. Und manche Katze (wie auch mancher Kater) wird nachts erst so richtig aktiv. Was jedenfalls richtig ist und was der Volksmund, wie wir ihm zugutehalten wollen, wohl auch andeuten will, ist jene Perspektivenverschiebung, die sich nachts ereignet. Die Nacht ist eine grosse Metapher: für das andere, Dunklere, auch Dämonische, für die Verwischung von Unterschieden und Prioritäten. Nachts fallen gerne ein paar Hemmungen und Rationalisierungen, der Mensch ist näher an seiner Urnatur; der Volksmund, bisweilen strikt, spricht auch von lichtscheuem Publikum, worin stets ein wenig Anerkennung mitschwingt. Nachts aber ist die natürliche Zeit auch eines Typs, der nicht eben lichtscheu ist, jedenfalls sofern das Licht vom Blitz der Paparazzo-Kamera stammt. Die Rede ist von ihm, dieser ominösen, sagenumwobenen Gestalt: dem Playboy.
Was ist ein Playboy?
Zum ersten Mal tauchte der Begriff «Playboy» im «Oxford English Dictionary» im Jahre 1828 auf. Dort hiess es dazu in enzyklopädischer Knappheit (frei übersetzt): «eine Person mit Geld, die zu ihrem Vergnügen auf der Welt ist». Im Jahre 1907 erschien in der Komödie «The Playboy of the Western World» des irischen Dramatikers John Millington Synge der Playboy erstmals als Tändler, Schwätzer, Schürzenjäger, Nichtstuer, Schwindler, Angeber. Eine ambivalente Figur also – aber langweilig ganz bestimmt nicht. Der Playboy als Frauenheld, Flaneur und Bonvivant erreicht dann seinen ersten Höhepunkt (if you’ll pardon the pun) in der Zeit zwischen den Weltkriegen, jenen rund anderthalb Dekaden in den Zwanziger- und Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts, die, nebst allem anderen, in der westlichen Welt auch eine Epoche des Glamours zwischen zwei Katastrophen waren, ein Tanz auf dem Vulkan. Dort erstand der Prototyp des Playboys: ein in jeder Hinsicht vermögender Mann mit Zeit für Müssiggang und Geltungskonsum – und Frauen. Der Playboy konnte gedeihen in dieser kurzen Ära, weil die Umstände günstig waren: Es herrschte Frieden, die Mobilität und der Reiseverkehr der privilegierten Sphären expandierten, und reiche Familien aus Adel und Industrie entfalteten ein reges Gesellschaftsleben; die Elterngeneration der Playboys waren nicht selten die Überlebenden jener sogenannten Café Society, womit ein wohlhabendes, klassenübergreifendes Milieu der Belle Époque gemeint war, das sich in den relevanten Cafés, Restaurants und Nachtclubs der Metropolen beidseits des Atlantiks einfand, gegenseitig zu Dinner Parties einlud und elegante Ferienreisen an Destinationen wie Acapulco oder an die Französische Riviera unternahm.
Die zweite, in der Auffassung mancher wohl noch drastischere Welle der Playboys rollte dann in den Nachkriegsjahren an: In den späten Fünfzigern begann der Ausdruck «Jet Set» endgültig den der «Café Society» zu ersetzen, und der Playboy war eine typische Jet-Set-Figur: stets braun gebrannt (nach Aristoteles Onassis eigentlich das Wichtigste überhaupt), jung oder alterslos, in der Regel aus wohlhabendem Hause, mit einer Vorliebe für schnelle Autos und lange Partys und schöne, berühmte, reiche Frauen (ungefähr in dieser Reihenfolge; falls alle drei Attribute zutrafen: umso besser). Auch auf professionelle Damen wurde zurückgegriffen, zum Beispiel auf die Dienste von Madame Claude, die in den Sechzigerjahren die exklusivsten Callgirls in Paris vermittelte. Denn ein starker sexueller Appetit (oder jedenfalls der Anschein nimmermüder Virilität) war ein Markenzeichen des Playboys. Dabei bewegte er sich auf einer feinen Linie zwischen Diskretion und Öffentlichkeit: Es gab kein Internet und keine Mobiltelefonkameras, was vieles ermöglichte, doch der Bildjournalismus und seine aggressivsten Vertreter, die Paparazzi, waren andererseits ein wichtiger Bestandteil des Image Building für den Playboy, der sich gerne ablichten liess, wenn er Lokale wie El Morocco, den Stork Club oder das 21 betrat, in Newport oder Palm Beach zum Segeln ging, Polo bei den Vanderbilts in Connecticut spielte oder ein paar Tage mit Playboy-Freunden in Havanna verbrachte, um das Tropicana zu besuchen. Auch der legendäre Nachtclub Jimmy’s am Pariser Boulevard Montparnasse war ein Freundestreff der Playboys. In der Tat hatten Playboys Rivalität selten nötig, pflegten vielmehr den Wert und Geist der Freundschaft. Was auch der Diskretion zugutekam.
Arbeitet der Playboy?
Es ist etwas umstritten, ob es eine notwendige Bedingung sei, dass ein Playboy nie arbeite (dann würde man so herrliche Exemplare aus den Gefilden von Showgeschäft und Spitzensport nicht mitzählen wie Errol Flynn, Robert Evans, George Hamilton oder George Best). Fest steht, dass reichlich Geld, woher auch immer, eine Voraussetzung des Playboy-Daseins darstellt: Der Playboy ist der begnadete Verschwender, gegen die Puritaner und Moralapostel der Zeit. Famoses Beispiel ist der Brasilianer Jorginho Guinle, Nachkomme einer der reichsten Familien Brasiliens, der unter anderem das Copacabana Palace Hotel in Rio gehörte. Jorginhos Mission bestand, neben mutmasslichen Affären mit Rita Hayworth, Lana Turner, Veronica Lake, Susan Hayward, Jane Russell, Marilyn Monroe, Jayne Mansfield, Kim Novak, Romy Schneider, Ava Gardener, Marlene Dietrich, Janet Leigh, Hedy Lamarr und Anita Ekberg, eben darinnen, so viel wie nur möglich von diesem Vermögen für sein Vergnügen auszugeben, und er starb bankrott im stolzen Alter von 88 im Jahre 2004.
Vor allem dieser lockere Umgang mit Geld sorgte dafür, dass Playboys in der Biederkeit der Nachkriegsjahre einen dubiosen Ruf bekamen, namentlich im deutschsprachigen Raum. Der Ruch des Müssiggängers, Geldverschwenders, Schwerenöters passte schlecht in die verklemmte Strebsamkeit insbesondere der deutschen Wirtschaftswunderjahre. Dem Playboy seinerseits aber waren solch bigotte Reservationen fremd. Der legendäre italienische Playboy Prinz Dado Ruspoli (auch bekannt als «World’s Most Handsome Man») antwortete einst auf die Frage «Haven’t you ever worked?» mit «No» und dem erklärenden Zusatz: «I’ve never had time.» (Einige Quellen schrieben diesen Ausspruch auch Porfirio Rubirosa zu, auf den wir noch zu sprechen kommen werden. Vielleicht haben auch beide Herren so was gesagt. Es passte jedenfalls auf beide.)
Der Playboy als Stilikone
Garderobe und Auftritt des Playboys sind stets tadellos, aber von gehobener Konventionalität; sartoriale Experimente sind seine Sache nicht. (Ausnahme: Fiat-Tycoon Gianni Agnelli, der zu den massgeschneiderten Anzügen von Caraceni in Mailand gerne mal Wanderstiefel oder eine absichtlich schief sitzende Krawatte trug, um das auszustrahlen, was der Italiener «Sprezzatura» nennt: die Kunst, mit viel Aufwand so zu wirken, als betreibe man gar keinen Aufwand.) Die Konventionalität seiner Garderobe ist, neben seiner wenig ambivalenten Sexualität (mögliche Ausnahme: Charlie de Beistegui), einer der wesentlichen Unterschiede zwischen einem Playboy und einem Dandy. Trotzdem – oder gerade weil er eben die ungezwungene Manierlichkeit perfektionierte – hat der Typus des Playboys auch ein paar Stilikonen hervorgebracht: John F. Kennedy, zum Beispiel, der den Ostküsten-Preppy-Stil zu einem garderobentechnischen Archetypus erhob.
Ein weiteres unverzichtbares Versatzstück des Playboy-Stil-Universums ist: das Auto. Ein Playboy ohne Auto ist überhaupt nicht vorstellbar. Ebenso wenig ein Playboy, der aus einem Toyota Prius steigt. Denn selbstverständlich geht nicht jedes Auto. Mehr noch als für den durchschnittlichen Mann ist für den Playboy das Auto Symbol seiner Vitalität, Virilität, Visibilität. Und: Beweglichkeit. Der eben erwähnte Gianni Agnelli war immer in Bewegung – ob auf Ski in Cortina oder St. Moritz, im Jet zwischen zwei Konferenzen mit anschliessenden Nachtclubbesuchen in Paris, London, Buenos Aires oder mit seinem geliebten Ferrari auf der Corniche entlang der Riviera, einer typischen Playboystrecke. Die Verbindung vom Playboy mit Tempo und auch Rastlosigkeit ist natürlich besonders augenfällig bei den Playboys des Motorsports: beim britischen Rennfahrer James Hunt etwa, notorisch für seinen Sex-and-Drugs-and-Rock-’n’-Roll-Lebensstil sowohl dies- wie jenseits der Strecke. Hunt starb 1993 im Alter von 45 Jahren an einem Herzinfarkt, während das schnelle Leben einigen anderen Playboys noch direkter zum Verhängnis wurde: Der spanische Marquis Alfonso de Portago (Spitzname: «Partygo») kam 1957 bei einem spektakulären Unfall an der Mille Miglia ums Leben; Prince Aly Khan starb im Alter von 49 Jahren, als er in seinem Lancia auf dem Weg zu einer Party in Paris mit einem entgegenkommenden Wagen kollidierte.
Niemand jedoch legte ein grösseres Playboy-Ende hin als einer der mutmasslich fabelhaftesten Playboys aller Zeiten: Der dominikanische Diplomat Porfirio Rubirosa verschied im Alter von 56 Jahren in den frühen Morgenstunden des 5. Juli 1965, als er seinen Ferrari 250 GT in einen Kastanienbaum lenkte, auf der Fahrt von einer nächtlichen Feier des Sieges beim Poloturnier Coupe de France, im Jimmy's, natürlich. Das Ende der Nacht. Mehr Playboy geht nicht. Rubirosa, auch bekannt als «Toujours Prêt» bzw. «Always Ready» bzw. «Immer Bereit», personifizierte die Vorliebe für das leichte Leben, schöne Frauen, schnelle Autos, Sport und Spiel, Party und Vergnügungen und Nervenkitzel: der Archetyp des Playboys. Er war (kurz und in Folge) mit zwei der reichsten Frauen der Welt verheiratet (Doris Duke und Barbara Hutton) und zu seinen (bestätigten und unbestätigten) Affären und Ehefrauen gehörten Dolores del Río, Eartha Kitt, Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth, Soraya Esfandiary, Peggy Hopkins Joyce, Joan Crawford, Veronica Lake, Kim Novak, Judy Garland, Eva Peron, Flor de Oro Trujillo Ledesma, Zsa Zsa Gabor, Danielle Darrieux und Odile Rodin. Rubis Männlichkeit war schon zu Lebzeiten ein Mythos; 30 Zentimeter lange Pfeffermühlen wurden in Paris «Rubirosas» genannt. Von Eartha Kitt sind die Worte überliefert: «Rubirosa war wie Cary Grant, Errol Flynn, Charles Boyer, Burt Lancaster und Tyrone Power zusammen, und ich muss es wissen, denn ich bin mit allen ausgegangen.» Rubi selbst stellte lapidar fest: «Die meisten Männer wünschen sich nichts sehnlicher, als ein Vermögen zu verdienen, ich will nur ein Vermögen ausgeben.»
Die Dämmerung des Playboys
Als der 78-jährige Gunter Sachs sich im Mai 2011 in seinem Chalet in Gstaad erschoss, weil er nicht bereit war, seine fortschreitende Demenz länger zu akzeptieren, mischte sich in die Trauer auch das Gefühl vom Ende einer Ära: Der letzte Playboy schien die Bühne verlassen zu haben. Auch Gunter Sachs kam aus reichen Hause, seine Mutter war die Tochter von Wilhelm von Opel, sein Vater Willy Sachs Alleininhaber des Sachs-Konzerns. Auch Sachs liebte Sport und Spiel und Frauen und stieg spätestens nach seiner Eheschliessung mit Brigitte Bardot 1966 in die erste Liga der Playboys auf. Die Ehe hielt allerdings lediglich rund drei Jahre, angeblich nicht zuletzt deshalb, weil es der Bardot nicht gefiel, dass Gunter auch an ihrer Seite im Grunde ein Playboy blieb; er spielte Roulette in Monte Carlo und fuhr Bob in St. Moritz, denn für den richtigen Playboy spielte es eben nie eine besondere Rolle für seine Lebensgestaltung, ob er verheiratet war oder nicht, er machte einfach weiter.
Relativ dezidierte Ansichten hingegen schien Sachs über den definitiven Club der Playboys zu haben: «Zwölf und nicht mehr», pflegte er zu sagen. Und meinte damit, neben der eigenen Person: Porfirio Rubirosa, Gianni Agnelli, Howard Hughes, JFK, Francisco «Baby» Pignatari, Prinz Dado Ruspoli, Alfonso de Protago, Prinz Aly Khan, Errol Flynn, Jorge Guinle und Charlie de Beistegui. Das war in der Tat die Spitze der sozusagen professionellen Playboys der Fünfziger- und Sechzigerjahre. Und danach? Nichts mehr? Richtig ist, dass sich grundlegende Parameter änderten, und zwar eben schon Dekaden vor dem Suizid von Gunter Sachs. Die Sechzigerjahre brachten nicht nur eine Blütezeit der Playboys, sondern auch fundamentale soziale und ökonomische Umwälzungen in der westlichen Welt, die man in drei Dynamiken zusammenfassen kann: Die Geschlechterrollen wurden flexibler und die Menschen mobiler, und die Freizeit nahm zu. Mit anderen Worten: Reisen nach Acapulco waren nicht mehr so exklusiv, und Frauen waren nicht mehr unbedingt geschmeichelt, wenn man sie als Trophäen sah. Das nagte an den Grundfesten des Playboys. Spätestens seit Beginn des 21. Jahrhunderts wurde das Wort «Playboy», wie «Manager», nur noch selten benutzt; die Lebensform schien ausgestorben und höchstens noch in den geschützten Sonderformen des royalen Playboys (RP) zu überleben: Albert II. von Monaco, Prinz Laurent von Belgien, Prinz Jefri von Brunei. Und, natürlich, allen voran: Prinz Ernst August von Hannover.
Aber irgendwie wirkten diese Herrschaften nie so ganz überzeugend. Das Konzept schien nicht mehr ganz stimmig. Und in der Tat muss der Playboy sich entwickeln, wenn er überleben will. Erinnern wir uns dafür, auch wenn das zunächst paradox klingt, an die Playboy-Tugenden. Denn die gibt es. Damit wir uns nicht missverstehen: Der Playboy ist kein Gentleman (und hat dies auch nie angestrebt). Im Gegenteil: In seinem Wesen liegt vielleicht nicht nur eine gewisse Unstetigkeit und Egozentrik, sondern möglicherweise sogar ein gewisser Zug von Grausamkeit, Brutalität; ein reckenhafter Übermut, eine vielleicht etwas vorschnelle Bereitschaft, Schönheit schaffende Ungerechtigkeit anzuerkennen, ein aristokratisches Bewusstsein. Die stets prägnante britische Autorin Tanya Gold jedenfalls kam zu folgendem Schluss: «Playboys are the most morally dubious and naffest ‹icons› in the history of mass media; it is only justice that eventually they gave their collective name to a porn mag.»
Der Wert des Spiels
Frau Gold hat insofern recht, als eine gewisse Dichotomie im Playboy liegt, eine Ambivalenz, ein Zwiespalt, der in der Tat recht deutlich in der etwas tragischen Gestalt des «Playboy»-Gründers Hugh Hefner verkörpert wird: Der Playboy läuft und lebt auf einer feinen Linie zwischen kosmopolitischem Lebemann und tragikomischem Glüschteler. Umso wichtiger ist es, die Tugenden des Playboys zu betonen: den Wert der Freundschaft, zunächst (mögliche Ausnahme: Charlie de Beistegui). Dann: Grosszügigkeit. Der Hang zur Verausgabung, wie der Playboy ihn aufweist, ist unbedingt als Tugend aufzufassen, denn wie die meisten Leute, die einigermassen viel besitzen, ist der Playboy ja nicht materialistisch, er will nichts, denn er kann (wenigstens scheinbar) alles (und alle) haben, er strebt keinen Besitz um des Besitzes willen an; es geht ihm stets und vielmehr: ums Spiel. Er ist Genusssucher, aber nicht selbstsüchtig; er ist kein Nichtstuer, denn: Er spielt. Die Bedeutung des Spiels (eben: «Play») kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, gerade heutzutage, denn wir leben leider in Zeiten, da das Spiel, die genussvolle Verausgabung, mithin alles, was nicht sinn- und zielgerichtet scheint, wieder in ziemlich sittenstrenger Manier schlecht beleumundet wird. Wir aber müssen das Spiel – das Lockere, Ungezwungene, das Probieren auch, den Versuch, das Experiment – wieder viel wichtiger nehmen, die besten Eigenschaften des Menschen entfalten sich im Spiel, als Homo ludens, das Spiel ist das, worin Friedrich Schiller das den Menschen Charakterisierende, zu seiner eigensten Würde Erhebende begriff.
Und während eine neue pseudoökonomische Strenge von uns in vermeintlichen Krisenzeiten verlangen will, dass wir alles mit einem Preis versehen, sollten wir uns darauf besinnen, dass das spielvolle Geniessen eigentlich seinem Wesen nach preislos, weil scheinbar sinnlos ist: Es geht nur um die Feier und den Genuss des Lebens, seine Entdeckung, denn das Leben ist alles, was wir haben. Das ist die dritte Playboy-Tugend: der offene Geist, die kosmopolitische Gesinnung. Denn dass die Welt heutzutage immer kleiner zu werden scheint, heisst leider noch lange nicht, dass ihre Bewohner kosmopolitischer denken. Oder, wie es Graydon Carter, Chefredaktor von «Vanity Fair», in seinem Nachruf auf Gunter Sachs formulierte: «For it’s a subtle craft, the art of the playboy—the creation of a life of tasteful public and private pleasure—and it’s one that is completely lost on the rich of today. Many men think they’re playboys, but they invariably land wide off the mark. Surrounding yourself with champagne, fast friends, and paid escorts is the very definition of the word ‹loser›.»